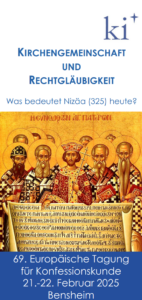 Das Jubiläumsjahr des Ersten Ökumenischen Konzils von Nizäa hat inzwischen zahlreiche Veranstaltungen hervorgebracht. Meistens steht dabei das Glaubensbekenntnis im Vordergrund, das bis heute in allen Konfessionen gebetet wird, das Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Es geht zwar in seiner trinitarischen Struktur auf das genannte Konzil von Nizäa zurück, stammt aber in seiner heutigen Form aus dem Jahr 381 und wurde auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil in Konstantinopel formuliert.
Das Jubiläumsjahr des Ersten Ökumenischen Konzils von Nizäa hat inzwischen zahlreiche Veranstaltungen hervorgebracht. Meistens steht dabei das Glaubensbekenntnis im Vordergrund, das bis heute in allen Konfessionen gebetet wird, das Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Es geht zwar in seiner trinitarischen Struktur auf das genannte Konzil von Nizäa zurück, stammt aber in seiner heutigen Form aus dem Jahr 381 und wurde auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil in Konstantinopel formuliert.
Die 69. Europäische Tagung für Konfessionskunde, die vom 21.-22. Februar 2025 vom Konfessionskundlichen Institut in Bensheim veranstaltet wurde, reiht sich in Fülle dieser Tagungen ein. Sie war dem Thema „Kirchengemeinschaft und Rechtgläubigkeit“ gewidmet mit dem Untertitel „Was bedeutet Nizäa (325) heute?“. Der Fokus lag damit nicht spezifisch auf dem Glaubensbekenntnis, sondern es ging um die Bedeutung der altkirchlichen Tradition allgemein für die heutige Praxis der verschiedenen Konfessionen und die Frage, wie innerkirchlich und im interkonfessionellen Dialog heute mit der Frage nach Rechtgläubigkeit und Häresie umgegangen wird.
Über 40 Teilnehmende fanden sich im Wolfgang-Sucker-Haus ein, um den 12 Vorträgen bzw. Impulsreferaten zu folgen und miteinander darüber zu diskutieren. Der einführende Vortrag des Patristikers Peter Gemeinhardt (Göttingen) skizzierte die Vorgänge auf dem Konzil von 325. Er hob die Innovation vor, die das Konzil für die Geschichte des Christentums bedeutete, denn hier gewann die allumfassende ‚katholische‘ Kirche zum ersten Mal sichtbare Gestalt. Gleichzeitig machte er auch den experimentellen Charakter dieses Konzils deutlich.
In den Impulsreferaten, die einen Einblick gaben, wie und wo die Ergebnisse des Konzils von Nizäa heute eine Rolle spielen, wurde deutlich, dass diese Rolle gewissermaßen graduell unterschiedlich ist. Am deutlichsten in der kirchlichen Praxis verankert sind das Nizänische Glaubensbekenntnis wie auch die kirchenrechtlichen Beschlüsse des Konzils im Bereich der orthodoxen Kirchen. In der römisch-katholischen Kirche zeichnet sich laut Christian Stoll (Paderborn) im Hinblick auf die Christologie eine Diskrepanz zwischen lehramtlichen Festlegungen und gemeindlicher Praxis ab. In der anglikanischen Kirche hat – wie Charlotte Methuen (Glasgow) darlegte – , das Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis seinen festen Platz im Gottesdienst, und auch die meisten kirchenrechtlichen Bestimmungen von Nizäa 325 sind umgesetzt. Im Bereich der evangelischen Landeskirchen in Deutschland stellte Jennifer Wasmuth (Göttingen) eine Differenz zwischen der theoretischen theologischen Bedeutung des Bekenntnisses von Nizäa bzw. seinem Folgetext von 381 und der Verwurzelung im Bewusstsein der Gläubigen fest. Aus dem großen Spektrum der Freikirchen hingegen berichtete Christoph Raedel, dass fest formulierte Bekenntnisse mit dem Verdacht des Formalismus behaftet sind, so dass persönlich geäußerte Bekenntnisse bevorzugt werden.
Am zweiten Tag ging es um die Frage nach dem Umgang mit abweichenden Glaubensauffassungen in den Kirchen heute. Stefan Dienstbeck, Systematiker an der Universität Rostock gab dazu einen grundlegenden Überblick, bevor diese Frage aus römisch-katholischer (Benjamin Dahlke, Eichstätt), neo-pentekostaler (Nikolai Kiel, Frankfurt), mennonitischer (Marius van Hoogstraaten) und orthodoxer Sicht (Alexei Volchkov, Tübingen) behandelt wurde. Obwohl der Begriff der Häresie heute kaum mehr benutzt wird, hat doch jede Konfession ihre Kriterien und Mechanismen, um die eigene Einheit zu bewahren.
Die Vorträge dieser Tagung werden in Heft 3/2025 des „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts“ veröffentlicht werden.


